30. Mai 2016 | Ausgabe 11
Bin ich ein textiler Junkie?
Die österreichische Bloggerin und Aktivistin Nunu Kaller hat ausprobiert, wie viel neuen Stoff man braucht, um glücklich zu sein. Im TrenntMagazin beschreibt sie ihren Mode-Entzug.

„Ich brauch ein neues Kleid!“ Das war der erste Gedanke, als ich von der Hochzeit einer Freundin meiner Mutter erfuhr. So richtig edel und nobel sollte die Feier werden. „Edel und nobel?“, dachte ich, „so was gibt mein Kleiderschrank nicht her.“ Also zog ich los, schlenderte durch die Geschäfte, durchwühlte die Kleiderständer. In einem Laden fand ich diesen Cordrock, den ich an einer Bekannten einmal bewundert hatte. Sie hatte ihn in einem wunderschönen Weinrot angehabt. Der, den ich gefunden hatte, war zwar kackbraun – aber egal, der Schnitt vom Rock war schön, und er war heruntergesetzt auf 15 Euro. Von „edel“ und „nobel“ war das Ding allerdings so weit entfernt wie Wien von Hamburg. Ich kaufte ihn trotzdem. Auf der Hochzeit trug ich dann ein zehn Jahre altes Kleid – und kassierte Komplimente.
Ich hätte den Zwischenfall leicht vergessen können, aber solche Momente waren bei mir immer häufiger vorgekommen: Ich ging shoppen und kaufte mir Kleidung, die ich schlichtweg nicht brauchte. Gut, wenn man ganz ehrlich ist, braucht man wahrscheinlich nur einen Bruchteil seiner Klamotten im Kleiderschrank. Das Pareto-Prinzip lässt sich auch auf unsere Kleiderschränke umlegen: 80 Prozent der Zeit tragen wir lediglich eine Auswahl aus etwa 20 Prozent des eigenen Kleiderschranks. Bei mir war das Shoppen sogar zum Hobby geworden. Dieser Kick, wenn ich etwas fand, das mir gefiel, passte und bezahlbar war, oder dieses Glücksgefühl, wenn man nach langer Suche eine ganz bestimmte Jacke endlich fand: unbeschreiblich! Und dank der Billigmode nicht unbezahlbar. Das Herrliche an diesen Kicks: Sie ließen mich kurzfristig den Stress vergessen, der zu dieser Zeit in meinen Alltag eingezogen war. Sich zu überlegen, wie der Rock in meiner Hand zu meinen Stiefeln zuhause passen würde, war so viel einfacher, als daran zu denken, wie es Mama wohl gerade bei der Chemotherapie ging.
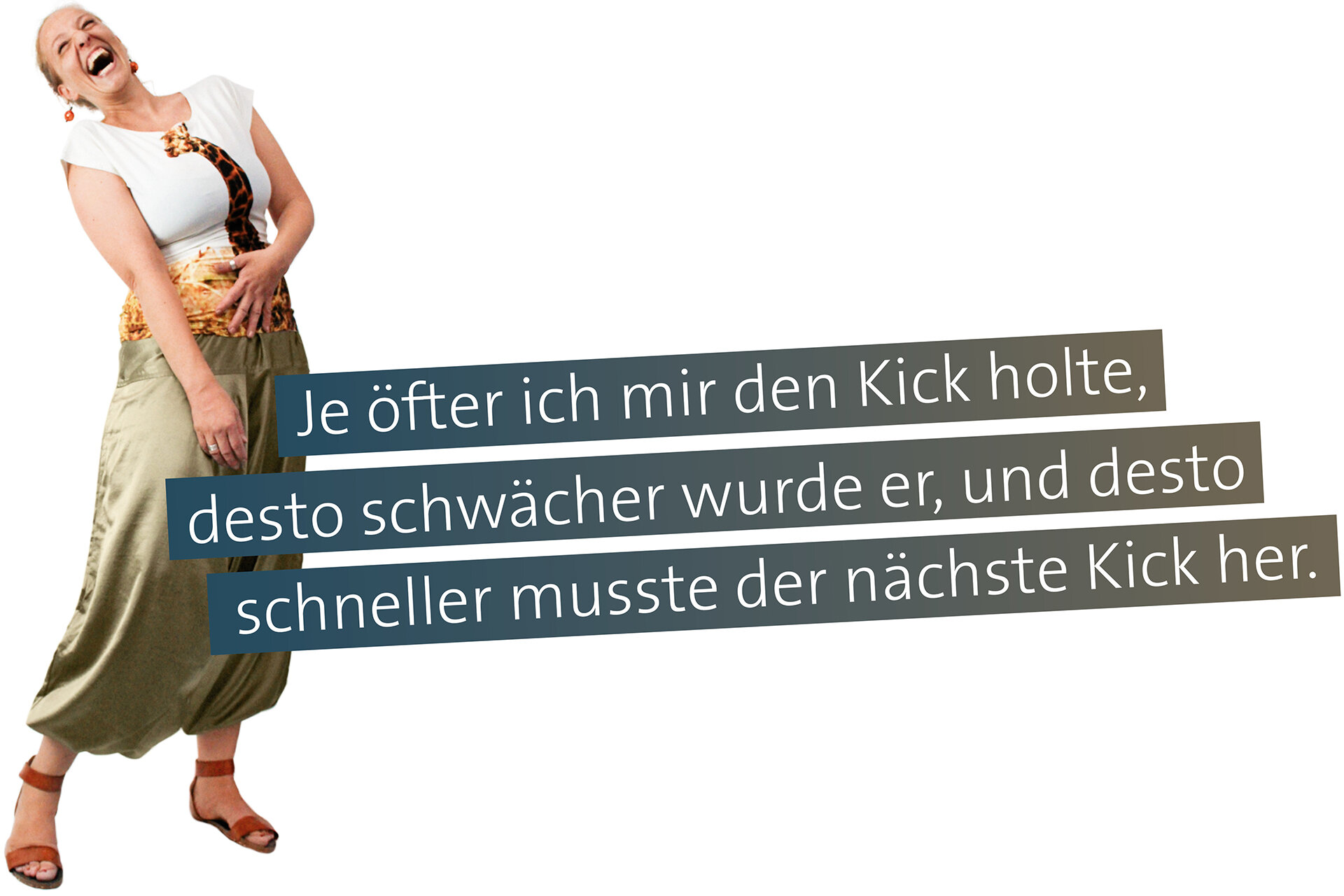
Doch je öfter ich mir den Kick holte, desto schwächer wurde er, und desto schneller musste der nächste Kick her. Ganz wie bei einer Drogensüchtigen. Mindestens einmal pro Woche schlug ich beim Heimweg aus dem Büro den Umweg über die Einkaufsstraße ein. Ich erkannte bereits beim Reinkommen in meinen Lieblingsläden, was neu in den Regalen und auf den Kleiderstangen gelandet war. Aber das Hochgefühl endete bereits, als ich zuhause die Sachen auspackte. Stattdessen breitete sich ein schlechtes Gewissen aus. Ich wusste, dass ich die Sachen nicht brauchte. Ich arbeitete bei einer Umweltschutzorganisation, und mir war bewusst, dass wir mit unserem Lebensstil die Ressourcen der Natur plündern. Aber während ich bei meiner Wohnungseinrichtung, beim Essen und bei meiner Fortbewegung immer wieder auch ökologische Faktoren berücksichtigte (also in der Stadt mit dem Fahrrad unterwegs war, mich mit alten Möbeln meiner Großeltern umgab und auf biologisches Obst und Gemüse achtete), machte ich bei der Kleidung bewusst die Augen zu.
Doch dann kam der Moment, an dem ich das ändern wollte. Ich packte mit meinem damaligen Freund die Koffer für unseren Urlaub. Er war in 20 Minuten fertig und hatte in der Tasche sogar noch Platz.
Ich musste fünfmal umpacken und dann trotzdem ein Paar Schuhe in seiner Tasche lagern. „Du hast einfach viel zu viel Zeug!“, schimpfte er. „Und du bist so inkonsequent!“ – das war einer seiner liebsten Vorwürfe an mich. Noch im Urlaub beschloss ich, dass ich es ihm und mir zeigen würde: Ein Jahr lang wollte ich keine neue Kleidung kaufen und mir in dieser Zeit anschauen, wo meine Sachen eigentlich herkommen. Kaum war ich aus dem Urlaub wieder zuhause, begann ich mit der Recherche. Wo wird die Kleidung, die man hier bei H&M, Zara und Co. bekommt, produziert? Wie wird sie produziert? Wer stellt sie her? Aus welchen Materialien? Was folgte, war die totale Überforderung. Ich klickte mich von einer Doku zur nächsten, saugte Infos auf wie ein Schwamm, las nur noch Sachbücher, die sich mit Textilproduktion beschäftigten. Ich erfuhr von den schrecklichen Arbeitsbedingungen in Produktionsländern wie China, Bangladesch oder Vietnam, stellte fest, dass die Produktion in Europa aber auch nicht automatisch bessere soziale Zustände bedeutet, ich sah Videos, in denen knapp 12-Jährige Jeans zusammennähten. Unsere Kleidung wird von den Ärmsten der Armen produziert, die sich ein solches Kleidungsstück selbst nie leisten könnten. Für ein Monatsgehalt von umgerechnet etwa 50 Euro arbeiten hauptsächlich weibliche Arbeitskräfte durchschnittlich 60 Stunden bei keinem oder maximal einem freien Tag pro Woche. Der Baumwollanbau ist in Indien am günstigsten, gewoben wird dann in der Türkei, und die Stoffe werden nach Bangladesch oder Pakistan gebracht, um vernäht zu werden – halleluja, globalisierte Welt! Ich erfuhr vom massiven Chemikalieneinsatz in der Industrie und dass in den asiatischen Fabriken die Abwässer sehr häufig ungeklärt in die Flüsse geleitet werden. Wasseradern, die früher der dortigen Bevölkerung als Trinkwasser dienten und an denen man nun an der Farbe des Wassers die kommende Trendfarbe identifizieren konnte.
Mir wurde klar: Die moderne Textilproduktion ist eine globalisierte soziale und ökologische Seuche, die sich immer schneller ausbreitet. Denn die Moden wechseln heute schneller denn je. Wenn man an die sechziger Jahre denkt, hat man Bilder von Petticoats im Kopf. Bei den Siebzigern kommen einem sofort Schlaghosen und abenteuerliche Farbkombinationen (violettorange!) in den Kopf. Aber wenn man an die nuller Jahre denkt? Was soll da die Mode sein? Dieses Jahrzehnt lässt sich nicht auf eine bestimmte Optik festnageln, zu viele unterschiedliche Trends wanderten durch die Modezeitschriften und Modefilialen.
Firmen wie Zara brüsten sich damit, Imitate großer Prêt-à-porter-Schauen innerhalb von drei bis sechs Wochen in den Filialen weltweit hängen zu haben. Je länger ich mich damit beschäftigte, desto überzeugter war ich: Diese schnelllebigen Modetrends werden nicht von den Konsumenten erzeugt. Die wollten doch wohl nicht ernsthaft plötzlich alle zwei Wochen ihr Geld in die nächste Fast-Fashion-Filiale tragen und dort dann immer etwas Neues vorfinden – sie (und auch ich) wurden dazu erzogen. Dieses unbewusste Anspruchsdenken auf permanent neue Fetzen wird in uns bewusst von der Industrie aufgebaut. Für den Profit der Modeindustrie, der immer schneller und immer weiter wachsen muss.
Um das shoppingfreie Jahr auch wirklich durchzuhalten, begann ich zu bloggen. Auf www.ichkaufnix.com dokumentierte ich meinen Fortschritt und teilte mit meinen Lesern die Fakten rund um die Textilindustrie, die mich bewegten oder sogar erschütterten.
Ich beschloss, Kleidung auch selbst herzustellen und dies zu dokumentieren. Während ich zum Nähen eine Hassliebe entwickelte, konnte ich vom Stricken gar nicht genug kriegen und ich musste aufpassen, dass ich da nicht direkt in die nächste „Sucht“ hineinschlitterte: Plötzlich entwickelten Wollgeschäfte eine wahnsinnige Anziehungskraft auf mich. Aber ich versuchte, hart zu bleiben und mich auch hier mit den Produktionshintergründen zu beschäftigen. Was mir jedoch immer wichtig war: Ich wollte nicht mit erhobenem Zeigefinger vor mich hin palavern, sondern immer auf Augenhöhe der Konsumenten bleiben. Ich war ja schließlich selbst eine, nur gerade auf Auszeit. Außerdem motivierte mich das öffentliche Schreiben: Ich hatte mir fest vorgenommen, im Falle eines Scheiterns dies auch dort zu dokumentieren. Der Blog erfreute sich sehr schnell hoher Beliebtheit – und vor so vielen Lesern zuzugeben, dass ich gescheitert war, wollte ich nicht.
Um das Happy End vorwegzunehmen: Ich habe es geschafft. Es ist in Wahrheit auch keine große Leistung. Ich habe nichts Weltbewegendes erreicht – und bin mir absolut darüber im Klaren, mich einem Luxusproblem gestellt zu haben. Und doch löste dieses Jahr etwas in mir aus, das ich nicht mehr umkehren kann: Ich will an der textilen Katastrophe keinen Anteil mehr haben. Gerade im Modebereich kann man wunderbar bei sich selbst anfangen. Ich persönlich habe meinen „roten Faden“ gefunden. Ich blogge nicht nur seit mittlerweile vier Jahren rund um die Themenfelder Fast Fashion und Slow Fashion, sondern bin auch seit zwei Jahren die Kampagnensprecherin für die Detox-Kampagne von Greenpeace in Österreich. Durch diese Kampagne hat Greenpeace bereits große Player wie Inditex (Zara) oder H&M dazu gebracht, ihre Lieferkette zu „entgiften“ und ihr Chemikalienmanagement zu überarbeiten und zu verbessern.
